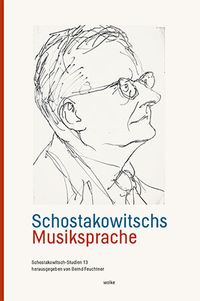Schostakowitsch-Studien
Schostakowitschs Musiksprache (Band 13)
Schostakowitschs Paradoxie ist unvermindert spannend – für das Publikum ebenso wie für die Wissenschaft. Der dreizehnte Band der Schostakowitsch-Studien bringt 34 Beiträge aus den Symposien 2019 und 2021 der Deutschen Schostakowitsch-Gesellschaft. Pioniere aus deren ersten Tagen kommen ebenso zu Wort wie der wissenschaftliche Nachwuchs und Vertreter von Nachbardisziplinen wie Film- oder Politikwissenschaft. Sie sind vielen verdeckten Hinweisen in der Musik selbst auf die Spur gekommen. Detailuntersuchungen zur Vierten, Sechsten, Neunten, Zwölften und Fünfzehnten Sinfonie, zur Cellosonate, zu den beiden Cellokonzerten, zur Bratschensonate und zum Zyklus der Präludien und Fugen bringen überraschende Einsichten. Sowohl das politische als auch das kulturelle Umfeld von Schostakowitschs Komponieren werden erhellt und es wird untersucht, wie weit es erlaubt ist, Schostakowitschs Werken Inhalte und Erzählungen zu unterschieben.
Häufig wurde der russische Komponist Gegenstand von Filmen und Romanen, oft wird seine Musik im Ballett verwendet – all das schafft neue Legenden. Heutige Musikfreunde hören Schostakowitschs Musik anders als seine Zeitgenossen, denen die klingende Welt von damals so selbstverständlich war wie dem Komponisten – „Fremde Stimmen – eigene Sprache“ nannte der Komponist Boris Yoffe seinen Vortrag. Andererseits stehen uns heute neue Noten- und Manuskriptausgaben zur Verfügung, die tiefere Einblicke in die Werkstatt erlauben. All das ist auch Gegenstand der aktuellen Schostakowitsch-Forschung. Einige englischsprachige Forscher haben sich in Vierzigjährigen Schostakowitsch-Kriegen verirrt und sich um Worte statt um die Musik gestritten. Das zeigt, wie wichtig eine eigenständige deutschsprachige Forschung bleibt.
Beim Symposium „Schostakowitschs Musiksprache – Kompositionstechniken und Narration“ wurden spannende Entdeckungen vorgelegt, so auf dem Feld der Groteske (Amrei Flechsig), in den Passacaglia-Sätzen (Wendelin Bitzan), im Spätwerk (Krzysztof Meyer), im Zusammenhang mit den Werken zu Dolmatowski-Texten (Dorothea Redepenning), bei der Filmmusik (Robert Rabenalt). Gottfried Eberle entdeckte verblüffende Brücken vom Jugend- zum Spätwerk
Auch dank großzügiger Spenden konnte der Druck des aufregenden 500-Seiten-Buches finanziert werden. Es kann beim Wolke-Verlag bestellt werden: ►
Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20. Jahrhunderts (Band 12)
Zweimal bekam Dmitri Schostakowitsch die Peitsche Stalins zu spüren, zweimal wurde ihm die Anwendung avantgardistischer Kompositionsmethoden und der Kontakt mit westlichen Komponisten verboten. „Formalismus“ und „Kosmopolitismus“ lautete 1936 und 1948 der Vorwurf gegen die sowjetischen Künstler. Wie Schostakowitsch darauf reagierte, mit Anpassung oder mit innerer Emigration, war lange umstritten. Die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft hat in bisher 19 Symposien der Erforschung der Musik von Dmitri Schostakowitsch gewidmet.
Im neu erschienenen Band 12 sind die Forschungsergebnisse der beiden Symposien gesammelt, die 2015 und 2017 in Berlin stattfanden und sich mit den vielfältigen Bezügen zwischen Schostakowitsch und den avantgardistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Unter der Lupe geben die Kompositionen oft erstaunliche Geheimnisse preis.
Vladimir Gurewitsch analysiert die atonalen und dodekaphonen Elemente in der Ersten Klaviersonate und deren Nähe zu Hindemith. Adelina Yefimenko findet Parallelen zwischen den ersten Sinfonien von Schostakowitsch und des Ukrainers Boris Ljatoschinski. Gottfried Eberle zeigt den biographischen roten Faden in den „Aphorismen“ samt deren Nähe zur Todesahnung des letzten Streichquartetts. Gerhard Müller erzählt von der Verbindung der Vierten Sinfonie mit der Ermordung von Maxim Gorki.
Bernd Feuchtner verfolgt die Entwicklung der Tanztypen von der Ironie zum Sarkasmus. Olga Dombrowskaja berichtet von dem seltsamen Fall der Lieferung absichtlich „dekadenter Avantgardemusik“ für einen Film. Brigitte Kruse untersucht das Missverständnis der Darmstädter Schule gegenüber Schostakowitsch. Johannes Schild analysiert die Verwendung von Zwölftonmusik im Früh- und im Spätwerk: Schostakowitschs Zwölftonfelder sind etwas anderes als Weberns Zwölftonreihen. Elisabeth Wilson geht Schostakowitschs Beziehung zu den italienischen Avantgardisten Maderna und Nono nach. Manuel Gervink schlägt eine Brücke von Wolfgang Rihm zu Schostakowitsch. Und vieles andere.
Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20. Jahrhunderts; Schostakowitsch-Studien, Bd. 12; herausgegeben von der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft; 248 S., 32 Euro, ISBN: 978-3-95593-105-6. Erhältlich im Buchhandel oder beim Verlag ►
In der Reihe Schostakowitsch-Studien sind bisher erschienen:
Durch Anklicken des kleinen schwarzen Dreiecks ► gelangen Sie zum Inhaltsverzeichnis des jeweiligen Buches.
Durch Anklicken des kleinen roten Dreiecks ► gelangen Sie zum Download des gesamten Buches.
Ernst Kuhn Verlag:
Michael Koball, Pathos und Groteske: Die deutsche Tradition im symphonischen Schaffen Dmitri Schostakowitschs. Kuhn Berlin 1997. studia slavica musicologica 10, 283 S. (Inhaltsverzeichnis ►)
Band 1: Schostakowitsch in Deutschland. studia slavica musicologica 13, 1998, 262 S. ►
Band 2: Dmitri Schostakowitsch - Komponist und Zeitzeuge ssm 17, 2000, 274 S. ►
Band 3: Dmitri Schostakowitsch und das jüdische musikalische Erbe (Andreas Wehrmeyer; Günter Wolter) ssm 18, 2001, 354 S. ►
Band 4: Das zeitlose Spätwerk (Sebastian Klemm) ssm 20, 2001, 343 S. ►
Band 5: Schostakowitschs Streichquartette – Ein internationales Symposium ssm 22, 2001, 304 S. ►
Band 6: Schostakowitsch und die Folgen – Russische Musik zwischen Anpassung und Protest ssm 32, 2003, 385 S. ►
Band 7: Einführung in die Klaviermusik von Dmitri Schostakowitsch (Alexander Alexejew/Wiktor Delson) ssm 44 (nicht erschienen)
Band 8: Die Opern Dmitri Schostakowitschs (Sigrid Neef) ssm47, 2010, 395 S. ►
Band 9: Dmitri Schostakowitschs Oper "Lady Macbeth von Mzensk" (Katerina Ismailowa) und ihre Inszenierungen (Rüdiger Haußmann) ssm 50, 2011, 285 S. ►
Band 10: Schostakowitsch-Aspekte - Analysen und Studien ssm 54, 2014, 389 S. ►
Band 11: Schostakowitsch, Prokofjew und andere Komponisten ssm 55, 2014, 330 S. ►
Schriftenreihe „Opyt“ (Erfahrungen):
Band 1: Daniel Shitomirski: Blindheit als Schutz vor der Wahrheit. Aufzeichnungen eines Beteiligen zu Musik und Musikleben in der ehemaligen Sowjetunion. 356 S.
Band 2: „Ideologisch entartete Elemente“ – Dokumente zur Ausbürgerung von Galina Wischnewskaja und Mstislaw Rostropowitsch aus der ehem. UdSSR. 1996, 132 S. ►
Band 3: „Volksfeind Dmitri Schostakowitsch“. Eine Dokumentation der öffentlichen Angriffe gegen den Komponisten in der ehemaligen Sowjetunion. 287 S. ►
Info: Der Verleger Ernst Kuhn verstarb plötzlich und unerwartet, ohne seine Nachfolge geregelt zu haben. Nach seinem Tod wurde sein Verlag vom Vermieter offenbar entsorgt, d.h. das gesamte Lager und das Textarchiv wurden vernichtet. Deshalb sind bedauerlicherweise alle von ihm verlegten Bücher weder im Buchhandel noch bei der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft erhältlich. Wir verweisen auf öffentliche Bibliotheken, auf die Antiquariate oder auf die Möglichkeit eines kostenlosen pdf-Downloads auf dieser Webseite (oben, rote Pfeile).
Wolke-Verlag:
Band 12: Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20. Jahrhunderts, 2019, 246 S. ►
Band 13: Schostakowitschs Musiksprache, 2022, 510 S. ►
Weitere Sammelbände:
Klaus Wolfgang Niemöller (Hrsg.): Bericht über das Internationale Dmitri-Schostakowitsch-Symposium Köln 1985 (dt./russ.). Gustav Bosse Verlag Regensburg 1986, 612 S. ►
Hans-Joachim Hinrichsen, Laurenz Lütteken (Hrsg.): Zwischen Bekenntnis und Verweigerung. Schostakowitsch und die Sinfonie im 20. Jahrhundert. Zürcher Festspiele 2002. Bärenreiter Kassel 2005, 128 S.
Manuel Gervink, Jörn Peter Hiekel (Hrsg.): Dmitri Schostakowitsch. Das Spätwerk und sein zeitgeschichtlicher Kontext. Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 2006, 247 S. ►
Hartmut Hein, Wolfram Steinbeck (Hrsg.): Schostakowitsch und die Symphonie. Referate des Bonner Symposions 2004. Peter Lang 2007, 218 S. ►
Melanie Unseld, Stefan Weiss (Hrsg.): Der Komponist als Erzähler. Narrativität in Dmitri Schostakowitschs Instrumentalmusik. Ligaturen Band 2. Georg Olms Verlag Hildesheim 2008, 258 S. ►
Bernd Feuchtner: Not, List und Lust. Schostakowitsch in seinem Jahrhundert. Wolke Verlag Hofheim/Ts. 2017, 278 S. ►
In englischer Sprache:
Shostakovich: The Man and His Music. Ed. Christopher Norris. Marion Boyars, London 1982, 233 S.
Shostakovich Studies, Edited by David Fanning. Cambridge University Press, 1995, 280 S. ►
Shostakovich Reconsidered. Ed. Allan B. Ho, Dmitry Feofanov. Toccata Press London 1998, 787 S. ►
Shostakovich in Context. Edited by Rosamund Bartlett. Oxford University Press 2000, 224 S. ►
Shostakovich Studies 2, Edited by Pauline Fairclough. Cambridge University Press, 2010, 323 S. ►